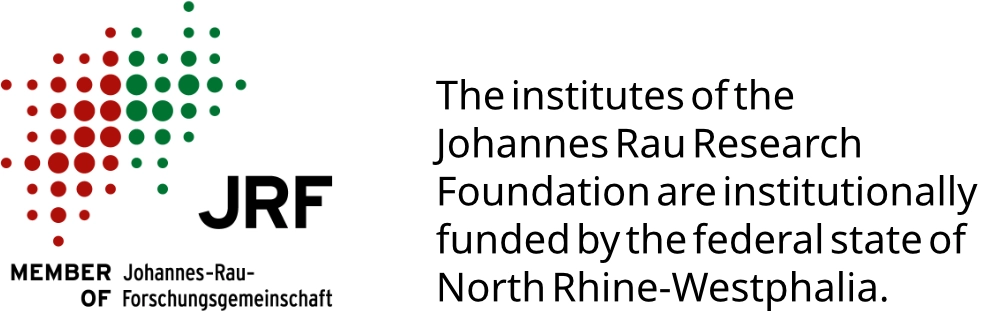Zeitz, Jana Friederike
Jana Friederike Zeitz, M.Sc. Geography
(area of specialisation: Urban and Regional Development Management)

Studied Geography with specialisation on Urban and Regional Development at the Department of Geography, Ruhr University Bochum.
Research interests:
- The right to the city
- Social and spatial inequality
- Urban and neighbourhood development planning
- Housing market and allocation strategies
Contact:
Phone: + 49 (0) 231 9051-244
E-Mail: jana.zeitz@ils-research.de
Jahresfeier der Johannes-Rau-Forschungsgemeinschaft
Am 24. April 2023 hat die Johannes-Rau-Forschungsgemeinschaft (JRF) Mitglieder, Förderer, Partner, Freund*innen und Interessierte zu ihrer Jahresfeier nach Düsseldorf eingeladen. Dabei standen persönliche Begegnungen und Gespräche im Vordergrund. In ihrem Grußwort wertschätze Ina Brandes, Ministerin für Kultur und Wissenschaft des Landes NRW, die Arbeit der JRF: „Die Leitthemen, auf die Sie sich verständigt haben, sind aus meiner Sicht für die Herausforderungen, die uns politisch, gesellschaftlich und sozial im Moment begegnen, genau die richtigen. Damit ist die JRF ein wichtiger politischer Ratgeber. Ich danke allen für ihre Arbeit. Sie können sehr stolz sein, auf das, was geleistet wurde und auch noch wird. Wir als Landesregierung stehen fest an ihrer Seite.“ Zur Pressemitteilung der JRF
Ab aufs Land!? Abschlusskonferenz des Projekt RURALIZATION in Brüssel
Das EU-Projekt „RURALIZATION – The opening of rural areas to renew rural generations, jobs and farms“hat Strategien entwickelt, die zur Wiederbelebung des ländlichen Raums beitragen sollen und dabei besonders jüngere Menschen und Neueinsteiger*innen in die Landwirtschaft in den Blick genommen. Auf der Abschlusskonferenz wurden beim Europäischen Ausschuss der Regionen in Brüssel nun die Ergebnisse vorgestellt. Mehr…
Ab aufs Land!? Abschlusskonferenz des Projekt RURALIZATION in Brüssel
Das EU-Projekt „RURALIZATION – The opening of rural areas to renew rural generations, jobs and farms“ hat Strategien entwickelt, die zur Wiederbelebung des ländlichen Raums beitragen sollen und dabei besonders jüngere Menschen und Neueinsteiger*innen in die Landwirtschaft in den Blick genommen. Dabei ging es auch um die Frage, welche politischen Maßnahmen und Möglichkeiten es gibt, den Start im ländlichen Raum zu erleichtern. Auf der Abschlusskonferenz wurden beim Europäischen Ausschuss der Regionen in Brüssel nun die Ergebnisse vorgestellt. Vertreter*innen der Europäischen Kommission und andere Expert*innen diskutieren, wie spezifische europäische Politiken zu einer langfristigen Vision für die ländlichen Räume der EU beitragen können. Ein Ergebnis ist das Tool „My Good Practice Guide“, das sich vor allem an ländliche Praktiker und Neueinsteiger*innen in die Landwirtschaft richtet und hilfreiche Tipps zur Entwicklung neuer innovativer ländlicher Projekte anbietet.
Das Projekt setzte sich aus 18 Organisationen aus 12 europäischen Ländern zusammen, darunter Universitäten, Forschungseinrichtungen, KMUs, Praktiker*innen sowie fünf Mitglieder des Access to Land Networks. In der ILS Research bestand das Projektteam aus Dr. Kati Volgmann (Leitung) und Florian Ahlmeyer.
Weiterführende Links
- Stream der Veranstaltung
- Website des Projekts mit Berichten und Videos
24. April 2023 – Ab aufs Land!? Abschlusskonferenz des Projekts RURALIZATION in Brüssel
Das EU-Projekt „RURALIZATION – The opening of rural areas to renew rural generations, jobs and farms“ hat Strategien entwickelt, die zur Wiederbelebung des ländlichen Raums beitragen sollen und dabei besonders jüngere Menschen und Neueinsteiger*innen in die Landwirtschaft in den Blick genommen. Dabei ging es auch um die Frage, welche politischen Maßnahmen und Möglichkeiten es gibt, den Start im ländlichen Raum zu erleichtern. Auf der Abschlusskonferenz wurden beim Europäischen Ausschuss der Regionen in Brüssel die Ergebnisse vorgestellt. Mehr…
21. April 2023 – ILS-Wissenschaftlerin Anna Wißmann bei Anhörung des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses
Unter dem Titel „Towards a European Food Policy Council as a new governance model in the future EU Framework on Sustainable Food Systems“ lud der Ausschuss im April 2023 zu einer öffentlichen Anhörung in Brüssel ein. Verschiedene Expert*innen gaben dabei Inputs zu der Frage, wie die Zivilgesellschaft sinnvoll und strukturiert bei der Ernährungspolitik auf allen politischen Ebenen beteiligt werden kann. ILS-Wissenschaftlerin Anna Wißmann stellte dort die Arbeit der Ernährungsräte im deutschsprachigen Raum vor. Sie sind eine erprobte Form der Ernährungsdemokratie, also der aktiven Mitgestaltung des Ernährungssystems durch Bürger*innen. Mehr…