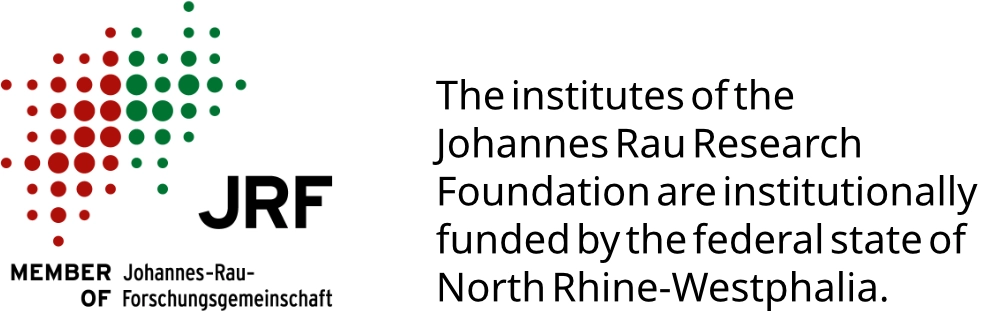Zeitz, Jana Friederike
Jana Friederike Zeitz, M.Sc. Geography
(area of specialisation: Urban and Regional Development Management)

Studied Geography with specialisation on Urban and Regional Development at the Department of Geography, Ruhr University Bochum.
Research interests:
- The right to the city
- Social and spatial inequality
- Urban and neighbourhood development planning
- Housing market and allocation strategies
Contact:
Phone: + 49 (0) 231 9051-244
E-Mail: jana.zeitz@ils-research.de
Pressemitteilung
Staatssekretärin Claudia Müller und Staatssekretär Jochen Flasbarth besuchen die »Agrarsysteme der Zukunft« beim Innovationsforum des GFFA
In diesem Jahr war die BMBF-Förderlinie »Agrarsysteme der Zukunft« erneut auf dem Innovationsforum des „Global Forum for Food and Agriculture (GFFA)“ vertreten, das vom 16. bis 17. Januar 2025 im CityCube der Messe Berlin stattfand. Zum Auftakt der Veranstaltung informierte sich Staatssekretärin Claudia Müller über die vielfältigen Forschungsprojekte am interaktiven Multitouch-Tisch.
Unter dem Leitthema „Bioökonomie nachhaltig gestalten“ brachte das GFFA auch in diesem Jahr Akteure aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft zusammen, um innovative Lösungen für die globalen Herausforderungen der Land- und Ernährungswirtschaft zu diskutieren. Die »Agrarsysteme der Zukunft« (AdZ) präsentierten sich beim Innovationsforum mit einem eigenen Stand, an dem Besucherinnen und Besucher die Möglichkeit hatten, sich über die verschiedenen AdZ-Forschungsprojekte zu informieren und das Zukunftsbild der Förderlinie kennenzulernen.
Staatsekretärin Claudia Müller vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft forderte die Veranstaltungsteilnehmer mit den inspirierenden Worten auf: „Make the world a better place!”. Im Rahmen ihres anschließenden Rundgangs besuchte sie den Stand der »Agrarsysteme der Zukunft« und führte ein intensives und aufschlussreiches Gespräch mit der Koordinatorin Prof. Dr. Monika Schreiner. Diese erläuterte das Zukunftsbild und die Vision der Förderlinie: „Auch wir möchten die Welt besser machen, denn wir stellen Mensch und Umwelt in den Mittelpunkt der Agrarwirtschaft.“
Am Nachmittag stattete auch Staatssekretär Jochen Flasbarth vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) dem Messestand einen Besuch ab. Mit seiner Forderung nach nachhaltiger Nutzung und der Erhaltung der Natur sind das zentrale Themen, an denen unsere AdZ-Konsortien intensiv forschen. Das Innovationsforum der GFFA ist der zentrale Treffpunkt für visionäre Ideen und zukunftsweisende Technologien, die auch die Agrarwirtschaft von morgen gestalten werden.
Weitere Informationen zum Konsortium finden Sie hier.
Walkability der Stadt Regensburg – eine Mixed-methods-Untersuchung mittels QGIS und Walk Audits
Together with other researchers, Dr. Christian Gerten from the “Geoinformation and Monitoring” unit has published an article in the journal “Prävention und Gesundheitsförderung”. The article presents the results of a study on the current walkability and pedestrian friendliness in the city of Regensburg and discusses and derives options for improving walkability. https://doi.org/10.1007/s11553-024-01165-5. Further current selected papers can be found here.
Neujahrsempfang Forum Stadtbaukultur
Im Gartensaal des Baukunstarchivs findet am 27. Januar 2025 um 18.30 Uhr der Neujahrsempfang des Forums Stadtbaukultur statt. Das Thema des Abends lautet: Infrastruktur der Zukunft – Zukunft der Infrastruktur. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, wird um Anmeldung gebeten bis zum 24.01.2025. Mehr…
Über die „Stadt im Wandel“: Straßenmagazin bodo berichtet über das Forschungsprojekt MaBIs, das marginalisierte Gruppen in der Innenstadt in den Blick nimmt
Das Forschungsprojekt „MaBIs – Marginalisierte Bevölkerungsgruppen und die solidarische Innenstadt“ strebt eine Transformation von Innenstädten an, die die täglichen Bedarfe und Praktiken marginalisierter Bevölkerungsgruppen mitdenkt. Das ILS kooperiert dabei mit den Straßenmagazinen bodo (Bochum und Dortmund) und BISS (München). Für den Artikel „Stadt im Wandel” hat bodo-Redakteurin Alexandra Gehrhardt mit ILS-Wissenschaftler Dr. Michael Kolocek über die Hintergründe des Projekts gesprochen. Die Ausgabe 01/25 wird gerade auf den Straßen und öffentlichen Plätzen in Bochum, Dortmund und weiteren Ruhrgebietsstädten verkauft. Mehr…
Über die „Stadt im Wandel“: Straßenmagazin bodo berichtet über das Forschungsprojekt MaBIs, das marginalisierte Gruppen in der Innenstadt in den Blick nimmt
Wenn über die Zukunft der Innenstädte diskutiert wird, sind oft die Meinungen und Ansprüche von Gewerbetreibenden, Anwohner*innen oder Kund*innen im Blick. Die Perspektive von marginalisierten Bevölkerungsgruppen, die als Straßenmagazinverkäufer*innen, Straßenmusiker*innen oder mit Betteln ihren Lebensunterhalt bestreiten, fehlt oft in den Überlegungen zur Zukunft von Innenstädten oder sie werden als Störfaktoren wahrgenommen.
Das Forschungsprojekt „MaBIs – Marginalisierte Bevölkerungsgruppen und die solidarische Innenstadt“ nimmt diese Menschen besonders in den Blick. Das Projekt strebt eine Transformation von Innenstädten an, die die täglichen Bedarfe und Praktiken marginalisierter Bevölkerungsgruppen mitdenkt.
Das ILS kooperiert dabei mit den Straßenmagazinen bodo (Bochum und Dortmund) und BISS (München). Für das Forschungsprojekt werden Straßenzeitungsverkäufer*innen als sogenannte Peer-Researcher beschäftigt, die gemeinsam mit Forschenden des ILS die Transformation der Innenstädte untersuchen und, im Sinne des Leitbilds der solidarischen Innenstadt, mitgestalten werden.
Für den Artikel „Stadt im Wandel” hat bodo-Redakteurin Alexandra Gehrhardt mit ILS-Wissenschaftler Dr. Michael Kolocek über die Hintergründe des Projekts gesprochen. Die Ausgabe 01/25 wird gerade auf den Straßen und öffentlichen Plätzen in Bochum, Dortmund und weiteren Ruhrgebietsstädten verkauft.
Das Projekt wird mit Fördermitteln der Volkswagenstiftung im Rahmen der Förderrichtlinie „Pioniervorhaben – Gesellschaftliche Transformationen“ finanziert.

© Carsten Nawrath/ILS