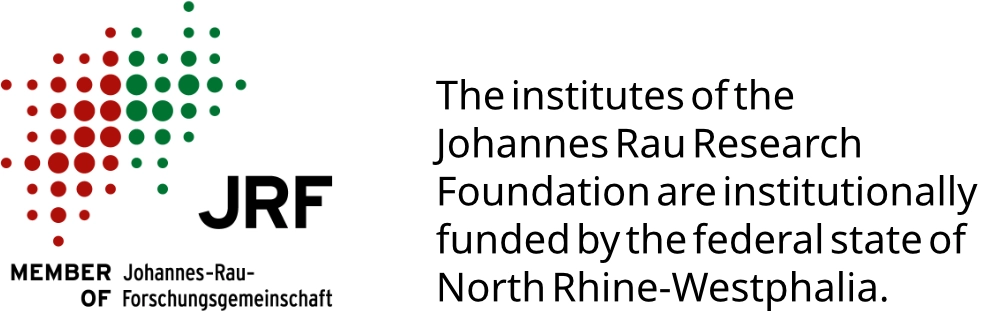Zeitz, Jana Friederike
Jana Friederike Zeitz, M.Sc. Geography
(area of specialisation: Urban and Regional Development Management)

Studied Geography with specialisation on Urban and Regional Development at the Department of Geography, Ruhr University Bochum.
Research interests:
- The right to the city
- Social and spatial inequality
- Urban and neighbourhood development planning
- Housing market and allocation strategies
Contact:
Phone: + 49 (0) 231 9051-244
E-Mail: jana.zeitz@ils-research.de
Call for Papers
Raumforschung und Raumordnung | Spatial Research and Planning
für ein special issue 2023 zum Thema „Innovative Ansätze der Daseinsvorsorge und ihre Verstetigung in ländlichen Räumen Europas“ // „Innovative Approaches to Services of General Interest and their Long-Term Establishment in Rural Areas of Europe”.
Globalisierung, Migration, Klimawandel, postfossile Transformation und urbane Wohnungsnot In der gesellschaftlichen Debatte werden die öffentlichen und privaten Dienstleistungen und Infrastrukturen der Daseinsvorsorge in ländlichen Räumen in Europa oft als defizitär dargestellt. Tatsächlich haben in diesem Kontext bedeutsame Umstrukturierungsprozesse bezüglich der Verfügbarkeit, Qualität und Erreichbarkeit bestimmter Dienstleistungen und Einrichtungen stattgefunden, sowohl bei staatlich wie insbesondere auch bei privatwirtschaftlich angebotenen Daseinsvorsorgeleistungen (Neu 2009; Naumann/Reichert-Schick 2015; Clifton/Díaz-Fuentes/Fernández-Gutiérrez 2016). Auch die Erwartungshaltungen und Ansprüche der Bürgerinnen und Bürger sind nicht statisch (Farmer/Nimegeer/Farrington et al. 2012). Jedoch führten die vielfältigen politischen, wirtschaftlichen und soziodemographischen Entwicklungen der letzten Jahrzehnte in Europa keinesfalls zu einem homogenen Trend der Verschlechterung der Daseinsvorsorge in allen Bereichen oder in allen Teilräumen. Einerseits wurden vielerorts Grundschulen und kleinere Lebensmittelläden geschlossen oder ihre räumliche Erreichbarkeit durch Standortverlagerungen eingeschränkt (Gieling/Haartsen/Vermeij 2019). Andererseits konnten ländliche Regionen auch Chancen nutzen, Verfügbarkeiten und Qualitäten in den Bereichen der technischen Infrastrukturen ausbauen und auch in sozialen Bereichen, wie der Kinderbetreuung oder der nachschulischen Bildung, neue Angebote erschließen (Steinführer 2020). Zugleich greift die Dichotomie von „Abbau versus Ausbau“ zu kurz, haben sich doch die strukturellen Rahmenbedingungen und Staatsverständnisse ebenso wie die Aufgabenteilung zwischen öffentlichen, privaten und gemeinwohlorientierten Akteuren in der Bereitstellung und Aufrechterhaltung grundlegender Leistungen und Einrichtungen der Daseinsvorsorge im Zuge von Privatisierung, De- und Re-Regulierungen sowie Finanzialisierung grundlegend verändert (z.B. Kersten 2006; Enjolras 2009; EU-KOM 2011). Das staatliche Engagement wird erneut vielerorts diskutiert zwischen der notwendigen Aufrechterhaltung staatlicher Daseinsvorsorgeangebote einerseits und der Schaffung hinreichender und zeitgemäßer Rahmenbedingungen für die privatwirtschaftlichen und zivilgesellschaftlichen Angebote – ob substitutiv oder ergänzend – andererseits.
Die kürzlich verabschiedete Territoriale Agenda der Europäischen Union stellt für 2030 einen bestehenden Handlungsbedarf eindeutig fest: Menschen und Orte driften im Zuge der zunehmenden Ungleichgewichte und Ungleichheiten unter anderem in den Bereichen „Lebensqualität“ und „Daseinsvorsorge“ auseinander (EU-KOM 2020). Wie unterschiedlich und standortabhängig die Verfügbarkeit, Zugänglichkeit, Bezahlbarkeit, Qualität und Vielfalt der Angebote in den Daseinsvorsorgebereichen tatsächlich sind, hat nicht zuletzt die COVID19-Pandemie zu Tage gefördert (Schorn/Franz/Gruber et al. 2021). Im Falle nicht weniger europäischer ländlicher Räume führen weiterhin die schrumpfende Bevölkerung und ungewisse ökonomische Perspektiven zu bedeutsamen Herausforderungen bei der Aufrechterhaltung einer angemessenen Daseinsvorsorge (Fassmann/Rauhut/Da Costa et al. 2015; Clifton/Díaz-Fuentes/Fernández-Gutiérrez 2016). Die ausschlaggebende Bedeutung regionaler Infrastrukturen für eine stärkere territoriale Kohäsion als Bindeglied zwischen urbanen, suburbanen und ländlichen Räumen im internationalen Kontext wurde beispielsweise von Addie, Glass, Nelles et al. (2020) herausgearbeitet.
In wohl allen ländlichen Räumen Europas wird nach Lösungen für diese Probleme gesucht. Einige Länder, z. B. in Skandinavien oder Schottland, haben sich einen Namen als Vorreiter bei neuartigen Lösungsansätzen ländlicher Daseinsvorsorge gemacht (BMVBS 2013). Große Chancen werden zum einen in der Digitalisierung gesehen, aber nach wie vor auch in der aktiven Einbindung der Bürgerinnen und Bürger. Gleichzeitig ist letztere nicht unumstritten, wollen und sollen Bürgerinnen und Bürger doch nicht Ausfallbürgen für vormalige öffentliche Leistungen sein (Salemink/Strijker/Bosworth 2017; Tõnurist/Surva 2017).
Die Erprobung neuer Ansätze ist ein relevantes Handlungsfeld europäischer Förderpolitik, in deren Kontext Modellvorhaben erprobt und Pilotprojekte gestartet werden. Das meist große Engagement während der Förderphasen erlischt jedoch oftmals schnell auf dem schwierigen Weg der Verstetigung erfolgreicher Projektansätze (vgl. z.B. Shediac-Rizkallah/Bone 1998; Adelmann/Taylor 2003; Scheirer 2005). Deren langfristige Etablierung ist von erheblicher Bedeutung, und soll von der Übertragbarkeit guter Ansätze aus anderen Ländern profitieren.
Das special issue ist eingebunden in den Projektverbund InDaLE (2020–2022), in dem verstetigte innovative Ansätze der Daseinsvorsorge in drei europäischen Ländern (Österreich, Schweden und Schottland) untersucht und deren Anwendbarkeit und Übertragbarkeit auf ländliche Räume in Deutschland geprüft werden. Vor diesem Hintergrund beabsichtigt dieses Schwerpunktheft in empirischen, methodischen oder konzeptionell-theoretisch ausgerichteten Beiträgen den sozial- und raumwissenschaftlichen Forschungsstand zu innovativen Ansätzen der Daseinsvorsorge und ihre Verstetigung in ländlichen Räumen Europas aufzuzeigen.
Das Lernen von Beispielen guter Praxis zwischen verschiedenen europäischen Ländern kann – so unsere These – die Übertragung und Adaption innovativer Ansätze entscheidend fördern. In dieser Hinsicht besteht sowohl Forschungs- als auch Handlungsbedarf, denn es gibt zwar einige Übersichten vermeintlich oder tatsächlich „guter“ oder „bester“ Praktiken (z.B. BMVBS 2013), aber nur wenig vertiefende und kritische Forschung, die beispielsweise nach förderlichen wie hinderlichen Verstetigungs- und Innovationsfaktoren fragt oder die Maßstäbe für die Beurteilung einer Infrastrukturlösung als „gute“ Praxis offenlegt (z.B. Küpper/Tautz 2015; Schaeffer/Hämel/Ewers 2015). Somit besteht ein Erkenntnisdefizit in der Forschung bezüglich der genauen Verstetigungs- und langfristigen Etablierungsprozesse solcher innovativen Projekte, was beispielsweise für den Wissenstransfer in vergleichbare Praxisprojekte oder die künftige Gestaltung von Förderprogrammen von hoher Bedeutung wäre.
Für eine erfolgreiche Verstetigung und Übertragung innovativer Ansätze spielt die Berücksichtigung harter und weicher Kontextfaktoren in den betrachteten Ländern eine entscheidende Rolle. Neben institutionellen Rahmenbedingungen, dem Wirken staatlicher und gesellschaftlicher Akteure und nationaler Finanz- und Wohlfahrtspolitik sind bei der Bereitstellung von Daseinsvorsorgeleistungen insbesondere die Entwicklung und Etablierung neuartiger Formen der Governance relevant (Jann 2002; Jessop 2016). Schließlich spielen nicht nur die strukturellen Rahmenbedingungen eine entscheidende Rolle, sondern es geht auch um Grundhaltungen und Überzeugungen von Akteuren aus den Bereichen des Staates, des Marktes und der Gesellschaft. Dabei wird regionsbezogenen Praktiken zur Koordination, Aushandlung und Bereitstellung von Dienstleistungen und Infrastrukturen der Daseinsvorsorge eine zunehmende Bedeutung zugesprochen (March/Olsen 2006).
Mögliche Beiträge können sich unter anderem mit folgenden Themen befassen:
- Erfolgreiche oder gescheiterte Strategien der dauerhaften Sicherung standortgebundener oder mobiler Infrastrukturen für schrumpfende ländliche Räume in Europa
- Vergleichende Analysen der Governance-Modelle bei innovativen Ansätzen der Daseinsvorsorge in unterschiedlichen europäischen Ländern sowie die Diskussion ihrer Vor- und Nachteile
- Darstellung innovativer Praxisprojekte (einschließlich Erfolgsfaktoren und Stolpersteinen) – Achtung: Eine alleinige Projektdarstellung (Steckbrief o.ä.) ist hierfür unzureichend. Zu einer Darstellung gehört die Einbettung des Praxisprojektes in einen theoretischen bzw. konzeptionellen Rahmen sowie in den internationalen Forschungsstand
- Erkenntnisse aus Experimentierräumen im Kontext spezifischer Förderprogramme bzw. Modellvorhaben
- Bedeutung von öffentlichen Dienstleistungen und Infrastrukturen der Daseinsvorsorge für die Resilienz ländlicher Räume in der Zeit nach der COVID19-Pandemie (verbunden z.B. mit der Frage, ob bisherige „gute“ Daseinsvorsorge-Praktiken weiterhin als solche gelten können)
- Verwandte Konzepte und Entwicklungen mit Einfluss auf die Bereitstellung und Verstetigung von Daseinsvorsorgeleistungen und Infrastrukturen in ländlichen Räumen Europas (z.B. Wanderungsbewegungen, soziales Unternehmertum auf dem Land, Wandel des Ehrenamtsverständnisses und der Engagementskulturen in der Gesellschaft)
- Erfolgsfaktoren bei Verstetigungsprozessen innovativer Projekte und Initiativen
- Methoden der Übertragbarkeit „guter“ Praktiken und das gegenseitige Lernen in unterschiedlichen europäischen Ländern
Beiträge können auf Deutsch oder Englisch verfasst und in den Kategorien „Beitrag / Article“ und „Politik- und Praxis-Perspektiven / Policy and practice perspective“ sowie „Rezension / Book review” eingereicht werden. Interessierte Autorinnen und Autoren werden gebeten, zunächst einen Abstract-Entwurf mit einem Umfang von 150 bis 250 Wörtern einzureichen, um eine thematische Passfähigkeit zum Schwerpunktheft sicherzustellen. Alle interessierten Autorinnen und Autoren werden darüber hinaus gebeten, die Autorenhinweise der Zeitschrift zu beachten (https://rur.oekom.de; Rubrik „Submissions“). Alle einzureichenden Manuskripte durchlaufen das übliche doppelblinde Begutachtungsverfahren.
Deadline für die Einreichung von Abstracts: 30. April 2022
Für weitere Informationen, Ihre Ansprechpersonen und den Zeitplan rufen Sie bitte den kompletten Call for Papers als PDF auf. Dort finden Sie auch die Angaben zur hier zitierten Literatur.
Pressemitteilung
URBAN AGRICULTURE FOR CIRCULAR CITIES – Are we ready to support commercial urban farming? –
The European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) and Food and Agriculture Organization (FAO) have been working on a technical cooperation package to support the agribusiness sector during the COVID-19 crisis, including a work area on Urban and Peri-Urban Agriculture. With more than 80 percent of food projected to be consumed in expanding cities by 2050, the need of shifting food production to urban areas is growing. But challenges multiply at the same pace.
To identify the promising areas for investment in urban and peri-urban agriculture, highlighting technologies, emerging business models and their feasibility, as well as main opportunities and risks, FAO conducted a global study that captured the current state of urban and peri-urban farming and initiated a series of online events on the topic. More than 500 market players and influencers – from both the public and private sectors – including farming companies, technology providers, research centres, real estate investors, retailers and farmers’ associations, have already been identified globally and engaged in this newly established networking platform.
After a successful launching event in November 2021, FAO and EBRD hosted today the second E-dialogue „Urban agriculture for circular cities: Space and logistic opportunities“ that gathered 130 participants from 40 countries, interested to learn more and exchange experience and insights in successful urban farming policies and initiatives. This was a unique opportunity for all to hear the voice of municipalities already engaged in urban farming such as Paris, Barcelona, Milano, Istanbul, Budapest, Sofia, Singapore, Beijing, Johannesburg, Washington, Montreal and many others, representing the five continents. Participants discussed the policies and regulation changes that enable public and private investments in urban agriculture and how the economic, social and environmental dimensions of sustainability are affected. After the opening remarks from EBRD and FAO representatives, project partners from the University of Bologna and academic institutions from Germany, Netherland, France, Spain, Hungary and Greece, moderated separated interactive discussions of participants with representatives of municipalities in four breakout rooms: Social Urban and Peri-Urban farming, Rooftop Agriculture, Agricultural parks and Vertical farming. Here participants discussed and analyzed how and to what extent local institutions and their administrations are ready to embrace commercial Urban Agriculture based on the latest technologies, and what is needed to create an enabling environment for investments.
The event was hosted by the land scape and urban horticulture international conference and the International Society for Horticulture Science, and organized in cooperation the European H2020 project Food Systems in European Cities (FoodE) and in collaboration with the sister actions “Fostering the Urban food System Transformation through Innovative Living Labs Implementation (FUSILLI)”, “Co-creating resIlient and susTaInable food systEms towardS FOOD2030 (Cities2030)”, “Building pathways towards FOOD 2030-led urban food policies (FOOD TRAILS)”, “Food System Hubs Innovating towards Fast Transition by 2030 (FoodShift2030)”and “FOOD and Local, Agricultural and Nutritional Diversity (FoodLand)”.
The urban farming is obviously gaining momentum and its active community is already nominating topics for the 2022 FAO-EBRD e-dialogues, to open up debates and shine a light on the potential pathways towards urbanizing food production.
Downloads
Pressekontakt:
Theresa von Bischopink
ILS, Stabsstelle „Transfer und Transformation“
Telefon: +49 (0) 231 9051-160
E-Mail: theresa.vonbischopink@ils-forschung.de
Fachpublikation
Holz-Rau, Christian; Heyer, Rabea; Schultewolter, Mirjam; Aertker, Johannes; Wachter, Isabelle; Klinger, Thomas (2021): Eine Verkehrstypologie deutscher Großstädte. In: Raumforschung und Raumordnung | Spatial Research and Planning, online first November 16, 2021. doi: 10.14512/rur.95. Weitere aktuelle Fachpublikationen finden Sie hier.
Fachpublikation
Hanhörster, Heike; Ramos Lobato, Isabel; Weck, Sabine (2021): People, Place, and Politics: Local Factors Shaping Middle-Class Practices in Mixed-Class German Neighbourhoods. In: Social Inclusion, Vol. 9, Issue 4, pp. 363–374. doi: 10.17645/si.v9i4.4478. Weitere aktuelle Fachpublikationen finden Sie hier.
Fachpublikation
Hunecke, Marcel; Heppner, Holger; Groth, Sören (2022): Fragebogen zu psychologischen Einflussfaktoren der Nutzung von Pkw, ÖPNV und Fahrrad (PsyVKN) – Faktorenstruktur, psychometrische Eigenschaften und Validierung. In: Diganostica, 68, 1, 3–13. doi: 10.1026/0012-1924/a000277. (online first 19.11.2021). Weitere aktuelle Fachpublikationen finden Sie hier.